Viktor Farkas ”MYTHOS INFORMATIONSGESELLSCHAFT”
Was wir aus den Medien nicht erfahren
Kopp-Verlag ISBN 3-938516-14-3
Dieses Buch können Sie auch direkt bei Amazon.de bestellen.
Viktor Farkas ”MYTHOS INFORMATIONSGESELLSCHAFT” Kopp-Verlag ISBN 3-938516-14-3 |
Leseproben
Heuschrecken-Investoren
 |
Als der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering vor der Nordrein/Westfahlen-Wahl 2005 manche Investoren als Heuschrecken bezeichnete, erntete er Kritik, Hohn und Spott. Zudem ging auch noch die Wahl verloren, was manche Beobachter weniger auf Münteferings „Griff in die altlinke Mottenkiste“ (so ein Kommentar) zurückführen, sondern eher auf ein Glaubwürdigkeitsdefizit. Mit solchen verspäteten Attacken warnte die SPD ihrer Ansicht nach im Grunde nämlich vor sich selbst. Schließlich hatten die Rot/Grünen doch grausame Sozial-„Reformen“ durchgezogen und gleichzeitig „Heuschrecken“ steuerlich vehement entlastet. Maßnahmen, die im linken Lager zu einem Aufschrei geführt haben dürften, wären sie von einer CDU/CSU/FDP-Regierung vorgenommen worden.
Fernab aller Polemik erscheint manchen nüchternen Analysten die Heuschrecken-Analogie gar nicht so unpassend, abgesehen von dem Faktum, daß Heuschreckenplagen ein natürliches Phänomen sind, was man von dieser ganz speziellen Investitionsform nicht unbedingt behaupten kann. Steuerreform und Agenda 2010 sollen nach Ansicht kritischer Wirtschaftsexperten einen gefährlichen Typ amerikanischer Investoren nach Deutschland locken, die nur daran interessiert sind, Firmen billig aufzukaufen, sie von „unnötigen Kosten“ - wie zum Beispiel Personal - zu befreien und sie dann mit Gewinnen weiter zu verscherbeln.
Mittlerweile sind solche Investoren bereits voll dabei „richtig viel Profit zu machen“, und das „mit dem Geld anderer Leute“, wie ein Filmtitel lautete. Fachleute erklären, wie das geht: Beispielsweise zahlt ein „Private-Equity-Fond“ 20 Millionen Euro für ein Unternehmen im Wert von 100 Millionen. Die offenen 80 Millionen des Kaufpreises muß das erworbene Unternehmen mit seinen Gewinnen abzahlen. Nach einigen Jahren verkauft der Investor die Firma um einen Betrag, der mindestens den Kaufpreis ausmacht, wobei im vorliegenden Beispiel satte 80 Millionen Euro Profit gemacht würden, da der „Geldgeber“ selbst ja nur 20 Millionen aufgestellt hat. Traumhafte Gewinne, erkauft durch die Verschuldung von Unternehmen, die in den meisten Fällen gar nicht gesund genug sein können, um das zu verkraften. Zyniker meinen dazu „Genuß ohne Reue“, weniger Ironische gemacht solches schon fast an Raubzüge, wobei einige sich sogar zu der „antiquierten“ Ansicht versteigen, ein Staat hätte solches eigentlich zu verhindern - notfalls sogar auf gesetzlichem Wege.
Den Grund dafür, warum gerade Deutschland für „Heuschrecken“ so attraktiv ist, sehen Fachleute in folgendem: Deutsche Firmen haben immer sehr stark in ihre Produkte investiert. Als Folge davon sind ihre Erzeugnisse qualitativ hochwertig und finden reißenden Absatz. Kurzum: Der Kauf solcher Firmen ist für Investoren ein unerhörter Hit.
Man kann ausschließlich Gewinn schöpfen und zwar Gewinn, der infolge nicht nötiger Investitionen kaum bis gar nicht geschmälert wird. Rationalisieren kann man auch, und zwar deshalb, weil Produkte, die ohnedies auf dem letzten Stande sind, nahezu keine Neuentwicklungen oder Verbesserungen erfordern, so daß die Abteilungen Forschung und Entwicklung größtenteils entbehrlich sind. Solche Firmen werfen über mehrere Jahre lang sagenhafte Gewinne ab, und ihre Aktien steigen in „himmlische Höhen“. Geht eine auf diese Weise behandelte Firma in den Konkurs ist es auch egal. Den Schnitt hat man ohnedies bereits gemacht. Ein solcher Art geführtes Unternehmen erwirtschaftet nämlich realistisch in den ersten fünf Jahren pro Jahr 30 bis 50 Prozent Gewinn. Behält man es fünf Jahre lang ohne auch nur einen Cent zu investieren (was in vielen Branchen an der Tagesordnung ist), hat man nach längstens drei, manchmal auch zwei Jahren, das investierte Kapital zur Gänze zurückbekommen und während der letzten zwei, drei Jahre insgesamt 60 bis 90 Prozent Gewinn gemacht.
Natürlich fällt es gelegentlich auf, wenn ein Musterbetrieb plötzlich zusammenkracht. Dann treten Medien und Eliten auf den Plan, welche das Geschehene mit routiniert vorgetragenen Formeln zum Naturgesetz erklären. Der Mittelstand brauche starke Partner, heißt es. Es soll zwar vereinzelt Fälle geben, in denen die Investoren profitable Unternehmen ohne Rücksicht auf die Substanz melken, aber das sei eben der Preis des Fortschritts. Eine andere Möglichkeit, um die Unternehmen für den globalen Wettbewerb fit zu machen, gäbe es nun einmal nicht. Eine Meinung, die von namhaften Fachleuten keineswegs geteilt wird. Für sie ist die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitssektor keineswegs naturgegeben, sondern ein geplanter Rückfall in die Zustände der frühindustriellen Ära.
Gewissermaßen ist es heute in mancherlei Hinsicht sogar noch schlechter. Vor hundert Jahren gab es nämlich noch keine Globalisierung; da mußten sich die Unternehmer den diversen berechtigten Wünschen und Forderungen ihrer Belegschaft stellen. Schon eine ernsthafte Drohung mit Streik führte oft zum Einlenken der Firmeneigentümer und Direktoren. Heute verpuffen solche Drohungen. Die Streikenden werden ohnedies nicht gebraucht, denn Auslagern ist die Devise. Und dem Investor in Minnesota sind Proteste vor seinem Betrieb in Deutschland ohnedies völlig gleichgültig. Über den Atlantik werden die Empörten ja kaum kommen. Doch selbst bei einer Deckungsgleichheit von Firmenleitung und Produktion genügt die simple Drohung einer Produktionsverlagerung oder eines Standortwechsels ins „billigere Ausland“; schon fürchtet jeder gleich um seinen Job. Man arbeitet um den selben Lohn oder sogar um weniger Geld länger und man verzichtet auf vor langem erkämpfte soziale Errungenschaften. Mit anderen Worten: man läßt die sprichwörtlichen Hosen nicht mehr nur runter, man zieht gleich ganz aus.
Berichten zu Folge haben die 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands ihre Gewinne im Jahr 2004 auf 35,7 Milliarden Euro verdoppelt und gleichzeitig in Deutschland gemeinsam knapp 35.000 Stellen abgebaut. Illusionslose Fachleute erwarten, daß große Teile West- und Mitteleuropas auf diese Weise regelrecht de-industrialisert werden, nicht zuletzt, weil das einzige Mittel, um das zu verhindern eine gewaltige Förderung des eigenen Hirnschmalzes wäre, zu der es aber aufgrund von Sparmaßnahmen bei der Ausbildung nicht zu kommen scheint.
Privatisierungslügen
Eine Frage: Wollen wir Verhältnisse wie diese, die bei uns im 19. Jahrhundert geherrscht haben und die in den Privatisierungs-Paradiesen USA und Großbritannien im Prinzip an der Tagesordnung sind?: Wie in Indien kann man auf Beschäftigte stoßen, die tagsüber einer regulären Tätigkeit nachgehen und die Nacht, nicht selten mit ihren Kindern, in Obdachlosenasylen verbringen. Tendenz steigend. Für diese neue „Arbeiterklasse“ gibt es zwar wenig Hilfe, wohl aber einen neu geschaffenen Begriff. Er lautet „working poor.“ Am ihrem Beispiel können wir wahrscheinlich ersehen, was die Privatisierer mit uns vorhaben.
Manchen dieser Unglücklichen ist sogar das Pinkeln verboten. Das private Pinkeln wohlgemerkt. Aspiranten auf einen Billigjob müssen nämlich zwecks Drogentests in eine Flasche pinkeln - um Schummeln zu vermeiden, nicht selten unter den Augen des Personalchefs (Frauen nicht ausgenommen). Einmal angestellt, hat es sich dann ausgepinkelt.
In der angelsächsischen sogenannten „Unternehmenskultur“ ist der Begriff des „Zeitdiebstahls“ eine fixe Größe. Dazu zählt mancherorten auch der Gang zur Toilette. Die Sozialwissenschaftler Prof. Marc Linder und Ingrid Nygaard haben 1997 das Buch „Void Where Prohibited: Rest Breaks and the Right to Urinate in Company Time“ herausgebracht. Darin heißt es: „Während wir über die Entdeckung entsetzt waren, daß Arbeiter kein anerkanntes Recht auf einen Toilettengang während der Arbeit haben, waren die Arbeiter erstaunt über den naiven Glauben von Außenstehenden, daß ihre Arbeitgeber ihnen erlauben würden, diesem elementaren körperlichen Bedürfnis nachzukommen. Eine Fabrikarbeiterin, der über sechs Stunden keine Pause gestattet wurde, mußte sich in Papierwindeln entleeren, die sie unter ihrer Arbeitskleidung trug.“ Dessen ungeachtet schreitet die Privatisierung auch in unseren Landen munter voran.
In den USA (wo sonst?) liegt der Anteil des Dienstleistungssektors am Bruttosozialprodukt bereits bei über 70 Prozent, Tendenz weiter steigend. Europa hinkt mit „lediglich“ über 40 Prozent gewaltig nach, ist aber fest entschlossen, aufzuschließen. Wobei jene, die „fest entschlossenen sind“ keineswegs die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen. Diese darf nur die „Segnungen der Privatisierung“ genießen. Um welche Segnungen handelt es sich also? Experten geben nicht immer beglückende Antworten.
Die Konzerne versprechen den Verbrauchern billigere Preise und den Kommunen Einnahmen. Wie man am Beispiel der Privatisierung von europäischen Eisenbahnen beobachten kann, stellt sich die Praxis manchmal anders dar. Mit der Umwandlung der Bahn in ein privatrechtliches Unternehmen stiegen in einigen Ländern nicht nur die Preise für Bahnfahrten kräftig an, sondern auch die Todeszahlen durch menschliches oder technisches Versagen, oder wie immer man die Vernachlässigung der Sicherheit zugunsten der Rentabilität auch nennen mag. Am extremsten ist das bei der in zig Privatgesellschaften aufgesplitterten „British Railway“. Mittlerweile sollen Landreisen in England wieder das Gefahrenniveau des Mittelalters aufweisen. Auch wenn die Globalisierung noch so gelobt wird, der Bürger fährt nun mal nicht gerne in Zügen ohne die eine oder die andere Bremse, weil deren Einbau nicht „wirtschaftlich“ ist.
 |
Trotz aller Einsparungen mußten Bahnen weiter und sogar in gestiegenem Maße massiv mit Subventionen gefüttert werden (in Deutschland sollen sie auf das zehnfache angestiegen sein). Nicht grundlos wird allenthalben beklagt, daß die Verlagerung auf die Schiene nicht und nicht klappen will. Ein Ausweg wie der, ins eigene Auto mit funktionstüchtigen Bremsen umzusteigen, statt eine teure Eisenbahnkarte für eine Fahrt in einer Garnitur mit Bremsen unbekannten Zustandes zu lösen, ist jedoch nicht in allen Bereichen möglich, nach denen die Privatisierer die Hände ausstrecken. Wasser zum Beispiel braucht jeder - darum wollen es auch alle in ihrer „Produktpalette“ haben.
Nachdem die Weltbank Bolivien zur „Wasserprivatisierung“ gezwungen hatte, erhielt 1999 ein amerikanischer Baukonzern, der sich seit dem Irak-Krieg von 2003 in dem verwüsteten Land eine goldene Nase verdient, von der bolivianischen Regierung die Konzession zur Wasserversorgung. Binnen weniger Wochen stiegen die Kosten für die Wasserversorgung um 200 Prozent. In Cochabamba, der drittgrößten Stadt des Landes, kam es zu Aufständen, die sich auf das ganze Land ausweiteten. Nach einigen Monaten heftiger Auseinandersetzung verließen die Manager fluchtartig das Land.
Solange Konzerne in Bolivien das Monopol auf die Wasserversorgung inne hatten, wurde Bewohnern von Armenvierteln per Gerichtsbeschluß untersagt, Regen in Wannen zu sammeln, um ihn als Trink- oder Waschwasser zu verwenden. Durchschnittlich arme Familien mußten bis zu einem Drittel ihres Monatseinkommens für den Wasserverbrauch aufwenden.
In Jakarta, wo die öffentliche Wasserversorgung vor Jahren an Private übertragen, danach wieder in staatliche Hände rückgeführt und schließlich abermals an zwei Wassermultis verhökert wurde, dreht sich die Preisspirale munter und unaufhörlich. Wie berichtet wird, stieg im April 2003 der Kubikmeterpreis für Wasser um 40 Prozent auf 49 Cent. 2004 erhöhte die Stadtverwaltung die Wasserpreise abermals um 30 Prozent, ausdrücklich auch für die ärmeren Haushalte und Stadtviertel. Anfang 2005 setzte die Regulierungsbehörde erneut den Preis hinauf. Pro Kubikmeter kostete Trinkwasser nun 78 Cent. Laut Ankündigung soll es halbjährlich für alle privaten Konsumenten eine automatische Preiserhöhung über einen Zeitraum von fünf Jahren geben. Und das in einem Land, wo die große Mehrheit der Bewohner mit weniger als zwei Dollar am Tag auskommen muß. Dazu kommt, daß in Jakarta das „private Wasser“ nach Kritikern alles andere als ein wohlschmeckendendes Luxusgut ist. Wer es sich leisten kann, kauft weit teureres, in Flaschen abgefülltes Wasser.
Die Bevölkerung von Armenvierteln anzuschließen, lohnt sich für den Wasserkonzern mangels Kaufkraft der Kunden ohnehin nicht. Allerdings ließ sich der Wasserpreis nicht sosehr erhöhen, daß das Unternehmen davon die hohen Gehälter der europäischen Manager zahlen und Gewinne erzielen konnte. Deshalb weigerte man sich, den vertraglich vorgesehenen Ausbau der Versorgungsnetze vorzunehmen.
Die Weltbank übt konsequent massiven Druck auf die Regierungen von Ländern wie Ghana und Tansania aus, die Wasserwerke zu privatisieren, was steigenden Widerstand zur Folge hat. Seit der Jahrtausendwende kämpft in Ghana eine immer breiter werdende Koalition unterschiedlichster gesellschaftlicher Organisationen gegen den von der Regierung akzeptierten Weltbank-Plan der Wasserprivatisierung. Im Frühjahr 2005 gab es einen neuen Versuch, diese Privatisierung endlich durchzuziehen, denn die französischen und südafrikanischen Unternehmen drängen ihre Beauftragten. Die „Nationale Koalition gegen Wasserprivatisierung“ NACP hat Anfang Mai 2005 einen Solidaritätsaufruf verbreitet „Keep your hands off our water“, mit dem diese breite Widerstandsfront nun auch internationale Unterstützung sucht. In Uruguay stimmten am 31. Oktober 2004 mehr als 64 Prozent der Bevölkerung für einen Verfassungszusatz, der die Privatisierung der Wasserversorgung untersagt.
 |
Trotz aller Widerstände und Proteste geben die Privatisierer/Globalisierer nicht auf. Warum sollten sie auch, angesichts gewaltiger Erfolge im Herzen Europas?
Großbritannien ist innerhalb der EU der Spitzenreiter der Wasserprivatisierung. Während die katastrophalen Zustände bei den privatisierten Bahnen wegen schwerer Unfälle des öfteren für Schlagzeilen sorgen, ist weit weniger bekannt, daß es bei der privatisierten Trinkwasserversorgung und der ebenfalls privatisierten Entwässerung nicht viel besser aussehen soll.
Bekanntlich wurde London die Olympischen Spiele 2012 vom Internationalen Olympischen Komitee übertragen. Wenig bekannt ist in dem Zusammenhang, daß die Möglichkeit, Fäkalien und tote Fische könnten während des Großereignisses die Themse hinuntertreiben, London Minuspunkte bei der ersten Prüfung der Kandidatenstädte eingetragen hat. Immer, wenn es etwas stärker regnet, reicht das städtische Kanalsystem nämlich nicht aus, und große Mengen ungeklärter Abwässer gelangen in die Themse. Im Jahr 2004 waren es 57,4 Millionen Kubikmeter. In London geht etwa ein Drittel des Wassers zwischen Wasserwerk und Wasserhahn durch Leckagen verloren. Mit dem versickerten Wasser ließe sich eine 2,5 Millionen-Stadt versorgen.
Der Grund, weshalb eine elementare Dienstleistung in dieser Weltstadt nicht funktioniert, ist für viele klar: Privatisierung. Nachdem diese von Premierministerin Margret Thatcher 1989 durchgesetzt worden war, entstanden zehn regionale private Monopole. Das Geschäft mit dem Wasser wurde zu einem großen Erfolg, allerdings nur für private Anleger. Die Kunden mußten hingegen drastisch steigende Wasserpreise hinnehmen. Das eingenommene Geld sollte angeblich in die Sanierung des Leitungsnetzes investiert werden, diente aber tatsächlich zur Erhöhung der Dividenden und der Managergehälter, ebenso der internationalen Expansion. Die „Daily Mail“ sprach deshalb schon 1994 von einem „großen Wasserraubzug.“
Nach Informationen, die auf Webseiten von Globalisierungskritikern publiziert wurden, soll es die führende Wasserfirma seit 1999 auf zwei Dutzend Verurteilungen wegen Umweltverschmutzungen gebracht haben. In einem Fall sollen in einem Stadtteil im Südosten Londons Straßen und Häuser von ungeklärtem Abwasser und giftigen Industrieabfällen überschwemmt worden sein. Einige Bewohner mußten im Krankenhaus behandelt werden. Häuser wurden unbewohnbar und schätzungsweise 22,5 Millionen Liter Abwasser und Industrieabfälle in die Themse gepumpt. Die Strafen von insgesamt 700.000 britischen Pfund konnte man allerdings aus der Portokasse zahlen.
Als besondere Raffinesse betrachten Insider den Kniff mancher Privatisierer, eine Gewinngarantie vertraglich festschreiben zu lassen. Erstaunlicherweise wird dies von Kommunen sogar akzeptiert, obgleich es nichts anderes heißt als daß die Steuerzahler(!) Verluste - oder nicht ausreichende Gewinne! - subventionieren, soll heißen begleichen müssen. Fallbeispiele werden genannt: 1999 wurden die Berliner Wasserbetriebe teilprivatisiert. Die Instandhaltungskosten der Anlagen wurden sofort nach der Privatisierung um 50 Prozent reduziert. Eingespart wurden diese vor allem bei mit Wartungsmaßnahmen beauftragten mittelständischen Betrieben, was zweierlei Folgen hatte: zum Einen verschlechterte sich der Zustand der Anlagen merklich, zum Anderen bedeutete es für viele kleine Betriebe den Ruin. Insgesamt hingen an diesen kleinen Unternehmen etwa 10.000 Arbeitsplätze, weitere über 1000 Arbeitsplätze sollen gefährdet sein. Darüber hinaus wurden die Preise für die Verbraucher um 15 Prozent erhöht.
Die Landeskasse erzielte durch die Teilprivatisierung einen einmaligen Gewinn von 1,73 Milliarden Euro, bei dem die langfristigen wirtschaftlichen Folgekosten von Betriebsschließungen und Arbeitslosigkeit nicht berücksichtigt sind. Zudem erwirtschafteten die Berliner Wasserbetriebe auch vor der Privatisierung jährlich einen nicht unbeträchtlichen Gewinn. Kulanterweise soll das Land Berlin den Betreiberfirmen eine Gewinnmarge garantiert haben, die gegebenenfalls aus der Landeskasse bezahlt werden muß.
Ähnlich die Situation bei den Gaswerken, die 1998 privatisiert wurden. Von den 2563 Arbeitsplätzen wurden mehr als die Hälfte abgebaut. Der Gaspreis erhöhte sich für die Verbraucher um 43,7 Prozent. Das Land verdiente an dem Verkauf der Gaswerke 721 Millionen Euro. Der geschäftstüchtige Aufkäufer veräußerte inzwischen allein das Gasnetz für 818 Millionen Euro an eine Münchner Leasing Firma.
Bereits 1977 wurde ein landeseigener Energieversorger zum Preis von 1,17 Milliarden Euro an drei Privatkonzerne verscherbelt. Das bedeutete für 4550 Menschen den Verlust des Arbeitsplatzes und für die Verbraucher einen Preisanstieg von 4,1 Prozent. Aus der jährlichen Dividende von 50,6 Millionen Euro, die das Land Berlin vor der Privatisierung erhielt, wurde lediglich ein „Mitsprachrecht“. Einer der drei privaten Käuferkonzerne verkaufte mittlerweile seinen zu 496 Millionen Euro erstandenen Anteil zum Preis von 1,71 Milliarden Euro weiter.
Kaum glauben wollten Aufdecker den Fall der staatlichen Bundesdruckerei Berlin: Für eine Milliarde verkauft, ging der Käufer bald mit 500 Millionen Euro Schulden in die Pleite. Die Bundesregierung sanierte daraufhin mit öffentlichen Geldern die Druckerei, in der auch Banknoten und Personalausweise gedruckt wurden, und verkaufte sie wiederum weiter an einen privaten Betreiber zum Preis von: einem Euro(!). 2310 Drucker verloren bei dieser Privatisierungsaktion ihren Arbeitsplatz.
Laut Meldungen sollen sich die Berliner Verkehrsbetriebe auf die Privatisierung vorbereiten. Konkret wurde angekündigt weitere 6000 Mitarbeiter zu entlassen; erste Preiserhöhungen wurden bereits abgesegnet sowie die Streichung des Sozialtickets betrieben. In diesem Zusammenhang sollen die verbliebenen Angestellten der Berliner S-Bahn eine Lohnkürzung von 30 Prozent hinnehmen haben müssen.
Auch ein Berliner Krankenhauskonzern, der jährlich 180.000 Menschen versorgt, wurde in die Teilprivatisierung geschickt. Die Einsparungen ließen nicht auf sich warten: Entlassungen, Lohnverzicht der Mitarbeiter, Schließung von Abteilungen, „Verdichtung“ der Arbeitsbelastung, Outsourcing selbst wesentlicher Versorgungselemente. Die Liste der Beispiele ließe sich fortsetzen.
Wenn solche „Erfolge“ angeprangert werden, widersprechen Privatisierungsverfechter mit dem bekannten Argument, selbst wenn einmal nicht alles profitabel abläuft, so seien die Verluste noch größer gewesen, als der Staat herumwirtschaftete. Tatsächlich?
Laut Informationen hatten beispielsweise deutsche Energieversorger früher, als sie noch von der öffentlichen Hand betrieben wurden, viel mehr Kapital akkumuliert als heute, wo es für die Kleineren unter ihnen schon schwer ist, überhaupt noch zu arbeiten. Bei Beginn der Privatisierung des Energiemarktes soll man damals vor unglaublichen 300 Milliarden DM Überschuß gestanden sein! Seinerzeit die größte Geldanhäufung in der BRD. Auch ohne diesen erstaunlichen Profit eines Staatsbetriebes, fragen sich manche, wieso Unternehmen, die im Staatsbesitz zugegebenermaßen Milliardenverluste produziert haben, verkauft werden „müssen“ sobald sie beginnen, hoch profitable Goldesel zu sein. Nicht selten wurden jahrelang Milliardenbeträge an Steuergelder in Staatsbetriebe gepumpt. Kaum waren sie gut geführt, ging der Gewinn jedoch nicht zurück an den Steuerzahler, sondern in die Taschen des privaten Besitzers. Fazit der Kritiker: Unfähige Politgünstlinge, die Staatsunternehmen ins Minus befördern gehören natürlich weg, nicht aber die Unternehmen selbst.
Halten wir fest, was von „Fortschrittsfeinden“ konkret angeprangert wird: Privat geführte Krankenhäuser lassen schwer kranke Kinder oft stundenlang unversorgt bis die private Krankenkasse der Eltern die Bezahlung zusagt. Fachleute sind sich ziemlich einig, daß das amerikanische Gesundheitssystem eines der ineffizientesten Systeme in der industrialisierten Welt ist. Es fallen wesentlich höhere Pro-Kopf-Ausgaben als in anderen Ländern an. Ein Grund, weshalb das System so schlecht funktioniert: Es wird privat geführt. Rund die Hälfte aller Insolvenzen in den USA haben mit unbezahlten Arztrechnungen zu tun.
Gewinnorientierte Gefängnisse streichen die Ausbildungsprogramme für Häftlinge und finanzieren die Wahlkämpfe von Politikern, die für längere Haftstrafen eintreten. Ungeachtet der Probleme in privat betreuten Haftanstalten in den USA oder auch in England, denkt man im Deutschland der leeren Kassen und der vollen Gefängnisse daran, Haftanstalten zumindest zum Teil zu privatisieren.
Um diese Raubritterkultur zu rechtfertigen, zitieren Privatisierungsfans gerne ihren Halbgott der „Laissez-faire-Ökonomie“, den englischen Ökonomen und Moralphilosophen(!) Adam Smith, womit sie den Begründer der klassischen Nationalökonomie posthum mißbrauchen. Würde er heute leben, so wäre gerade Smith ein erbitterter Gegner von globalisierten Privatisierung, Auslagerung und Lohndrückerei. Er geißelte zu seiner Zeit geheime Absprachen von Unternehmen, ungerechte Steuern sowie die Ausbeutung von Arbeitern und Gemeinden. Nirgends in seinem 900-seitigen Buch „Der Wohlstand der Nationen“ deutet Smith auch nur an, daß jene, die bei der Verfolgung ihrer persönlichen Gier besonders hemmungslos agieren, dadurch der Gesellschaft nützen würden. Den Gedanken, daß ein Unternehmen existiert, um Geld ohne ethische Beschränkungen zu machen, lehnte Smith stets kategorisch ab.
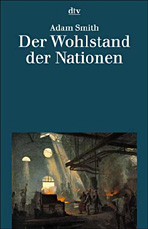 |
 |
| Adam Smith, (1723-1790), absolut kein Privatisierungsfreund. | |
Und vom Verkauf öffentlicher Versorgungseinrichtungen hielte Smith schon gar nichts, wie der von ihm vor über zweihundert Jahren kreierte Begriff „Common Good“ beweist, den man am besten mit „öffentliche Güter“ übersetzen kann. Für Smith war ein Gut dann öffentlich, wenn niemand vom Konsum dieses Gutes ausgeschlossen werden darf und es daher von allen Staatsbürgern konsumiert werden kann. Deutlicher gesagt: Alles was bei privater Herstellung nicht genug Gewinn abwerfen würde, muß eben vom Staat produziert und zur Verfügung gestellt werden. Handelt es sich um ein Naturgut wie Wasser, hat der Staat dafür zu sorgen, daß es zugänglich und erschwinglich ist, am besten kostenlos. Letzteres gilt natürlich auch für Luft, die derzeit noch kostenlos geatmet werden darf.
Das hindert aber anscheinen jene, die Smith oft und gerne im Munde führen, nicht daran, nicht ganz in seinem Sinne zu agieren. Wie es scheint, verabschieden sich die Staaten aufgrund des dogmatisch propagierten „Naturgesetzes“, demzufolge alles und jedes Profit abwerfen muß von ihren unterschiedlichen Versorgungsaufträgen. Daran dürfte wenig ändern, daß permanent vom öffentlichem Wohl die Rede ist während Krankenhäuser geschlossen und Leistungen reduziert werden. Verfechter der neoliberalen Wirtschaftsideen wollen nicht hinnehmen, daß ihr Glaubensgrundsatz, private Unternehmen würden überall besser arbeiten als öffentliche Betriebe, hundertfach widerlegt worden ist, ganz besonders bei der Wasserprivatisierung, die immer noch verbissen betrieben wird. Aufmüpfige fragen mittlerweile provokant „Wenn der Staat sich von seiner Versorgungsverpflichtung den Bürgern gegenüber verabschiedet, wozu zahlen wir dann eigentlich Steuern?“
Das Dr. Martin Luther King-Komplott
Manche sind überzeugt, die Ermordung ausländischer Staatschefs würde zu den Praktiken der geheimdienstlichen US-Außenpolitik gehören. Andere noch weiter und meinen, diese Praktik würde auch innenpolitisch angewendet. Sie verweisen auf die oftmals von seltsamen Umständen begleitete Ermordung unliebsamer Politiker im eigenen Lande und sonstiger öffentlicher Störenfriede. Als Musterbeispiele dafür werden die Kennedy-Brüder genannt, die nach immer verbreiteterer Meinung keineswegs von Einzeltätern getötet wurden, sowie auf den JFK-Sohn John John, der ebenfalls einem Attentat zum Opfer gefallen sein soll, und nicht wie offiziell behauptet, einem Flugzeugunfall (Ausführliches über das strittige Ableben der drei Kennedys findet sich in meinem Buch „Schatten der Macht“).
Auch das Attentat auf Dr. Martin Luther King wird in dem Zusammenhang zitiert, dessen angeblicher Einzelmörder James Earl Ray 1999 in einem spektakulären Prozeß offiziell rehabilitiert wurde. Seltsamerweise ging diese Sensation an der breiten Öffentlichkeit so gut wie komplett vorbei (man findet nicht einmal im Internet Substantielles darüber, lediglich eine arte-Dokumentation über die Verhandlung ist mir aufgefallen). Aus diesem Grunde erscheint eine nähere Betrachtung ebenso lohnend wie geboten.
 |
| Dr. Martin Luther King (1929-1968) |
Die wahren Hintergründe dieses politischen Mordes vom 4. April 1968 blieben Jahrzehnte im Verborgenen, obwohl der international renommierte Anwalt und Journalist William F. Pepper mehrfach vergeblich versucht hatte, eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erwirken. Unterstützt von der Familie Kings, konnte er erst 1999 ein Geschworenengericht in Memphis in einem Aufsehen erregenden Prozeß davon überzeugen, daß Dr. King einem Mordkomplott zum Opfer gefallen war, bei dem die amerikanische Regierung, das Militär, sowie FBI und CIA die Strippen gezogen haben sollen.
Über drei Jahrzehnte hatte sich die Öffentlichkeit mit einer simplen Erklärung für das Attentat auf Dr. Martin Luther King begnügt. Warum auch nicht? Schließlich war James Earl Ray ein Gelegenheitsdieb und Rassist, der sich am Vorabend des Mordes, am 3. April 1968, im Lorraine Hotel einquartiert hatte, von dessen Balkon aus die Schüsse gefallen sein sollen. Zudem hatte er ein knappes Jahr nach dem Mord ein Geständnis abgelegt, das er allerdings drei Tage später widerrief.
Ballistische Tests, die heute angezweifelt werden, ordneten die tödliche Kugel Rays Waffe zu. 1997 wurde in einer TV-Sendung eine gerichtliche Untersuchung der zwölf Testkugeln erwähnt, die aus der offiziellen Tatwaffe Earl Rays, einem .30-06 Remington-Jagdgewehr, abgefeuert wurden. Dabei soll sich ergeben haben, daß die von dem Lauf der Waffe auf den Testkugeln hinterlassenen Einkerbungen nicht auf der Todeskugel aus Martin Luther Kings Körper zu finden waren. Der Test war außergewöhnlich schlüssig, da Rays Waffe einen Herstellungsfehler aufwies, durch den abgefeuerte Kugeln in spezifischer, für andere Waffen untypischer Weise eingekerbt wurden. Ein Ergebnis, wie Forensiker es sich in allen Fällen wünschen. Als der Richter, der die Schußtests angeordnet hatte, eine weitere Testreihe anordnete, um jede Unsicherheit auszuschließen, wurde er von dem Fall abgezogen.
Ray wurde zu 99 Jahren Haft verurteilt. Bis zu seinem Tod 1998 beteuerte er immer wieder seine Unschuld und behauptete, ein Waffenhändler namens „Raoul“ hätte ihn an den Tatort gelockt, wo ein Unbekannter King erschossen habe.
Schon bald kursierten Gerüchte, bei dem Mord könne das FBI seine Hand im Spiel gehabt haben. Eine Theorie, für die sich Jahre später in der arte-Dokumentation Anhaltspunkte finden lassen, beispielsweise die ungewöhnlich schnelle Säuberung des Tatortes, usw. (manche vergleichen das mit der ebenso schnellen Reinigung des Wagens, in dem JFK erschossen worden war durch den Secret Service oder mit dem Ruck-Zuck-Verkauf der Überreste des WTC. Über den 11. September findet sich wenig Bekanntes in meinem Buch).
1998, im Jahr von Rays Tod, ging einer der beiden FBI-Agenten, die 1968 Rays Ford Mustang beschlagnahmt hatten, mit der Aussage an die Öffentlichkeit, er hätte damals zwei Stück Papier gefunden, die Rays Behauptung untermauern könnten, das Attentat sei eine Regierungsverschwörung unter FBI-Mitarbeit gewesen. Der Ex-Agent, der das FBI 1987 verlassen hatte, begründete sein langes Schweigen mit Mißtrauen gegenüber den Untersuchungsbehörden und mit Furcht um die Sicherheit seiner Familie.
Als der offizielle Attentäter im Sterben lag, bildete sich eine ungewöhnliche Allianz: Die Familie Martin Luther Kings tat sich mit Ray und seinen Anwälten zusammen, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Rays Anwalt William F. Pepper, nun auch Anwalt der Familie King, glaubt fest an eine Verschwörung. Seine langjährigen Untersuchungen stützen die immer wieder aufgetauchte Behauptung, Dr. King hätte sterben müssen, weil er durch sein Engagement gegen den Vietnamkrieg und gegen die Armut in Amerika zu einer Bedrohung für die US-Regierung und für die amerikanische Rüstungsindustrie geworden war.
Pepper hat einige Bücher über seine mehr als zwanzigjährigen Recherchen geschrieben, in denen er aufzeigt, wie von Regierungsseite wie auch von den Medien Beweise ignoriert wurden.
Der Prozeß, von dem niemand weiß
Nachdem am 9.12.1999 eine aus sechs Schwarzen und sechs Weißen bestehende Jury in Memphis zu dem Urteil gekommen waren, Dr. Martin Luther King sei nicht von einem Einzeltäter ermordet worden, sondern einem Komplott zum Opfer gefallen, sagte Dexter King, der jüngste Sohn des legendären schwarzen Bürgerrechtlers: „Wir wußten es doch die ganze Zeit.“ Trotz seiner Genugtuung äußerte er sich aber auch enttäuscht: „Ich kann es ehrlich gesagt nicht fassen, wie wenig es die Medien und die breite Öffentlichkeit interessiert, daß die amerikanische Regierung an dem Attentat auf den wichtigsten ‚african American’ in unserer Geschichte beteiligt war. Es hat sich eben doch nichts geändert.“
Für manche ist das Bemerkenswerteste an dem historischen Urteil, wie wenig Aufmerksamkeit die amerikanischen Medien dem Spruch der Geschworenen geschenkt haben.
Der geheime russisch-amerikanische Ölkrieg
Finden Sie es nicht eigentlich seltsam, wenn in einem verarmten, von Krisen geschüttelten Land wie Rußland, wo es manchen Bürgern fast schon so schlecht geht, wie einst im Zweiten Weltkrieg, einige von ihnen plötzlich zu Dollarmilliardären und zu Besitzern von Einrichtungen werden, die man mit Fug und Recht als Volksvermögen bezeichnen müßte? Laut Meldungen gab es 2005 mehr Milliardäre in Moskau als in New York und Rußland als Ganzes rangierte an dritter Stelle der Länder mit den meisten Dollarmilliardären.
Immer wenn der Versuch gemacht wird, Volksvermögen wieder in den Besitz des Staates rückzuführen - egal, ob das in Rußland, in Venezuela oder anderswo geschieht -, schreit der Westen Zeter und Mordio. Sollten Sie sich an die Berichte über die „Yokus-Rückverstaatlichung“ erinnern, so wird Ihnen sicher auffallen, daß sich die folgende aus verschiednen Quallen stammende Schilderung der Vorgänge stellenweise erheblich von dem unterscheidet, was durch die westlichen Medien ging:
Die Vereinigten Staaten hatten Ende der 1990er Jahre begonnen, die Entscheidungsschlacht um das russische Öl in perfekter Routine vorzubereiten. Sie hatten „Yukos“ im Visier, den größten Ölproduzenten Eurasiens. Aber erstmals in der langen Geschichte des „American Way of Business“ trat ein , was niemand für möglich halten hätte: Der geschulte Geheimdienstler Wladimir Putin erwies sich seinen amerikanischen Gegenspielern nicht nur ebenbürtig, sondern überlegen.
 |
Der Präsident der Russischen Föderation, ein wahrer „Schachspieler“ auf der politischen Bühne. |
Nachdem sich die USA Zugang zu den kaspischen Ölreserven der ehemaligen Sowjetrepubliken im Süden Rußlands verschafft hatten, nahmen sie die riesigen russischen Ölreserven aufs Korn. Mikhail Chodorkovsky, der damals reichste Mann Rußlands hatte mit „Yukos“ um rund 300 Millionen Dollar einen der größten Öllieferanten der Welt erworben, dessen Wert auf über 40 Milliarden Dollar geschätzt wurde. Woher die 300 Millionen Dollar für den Kauf von „Yukos“ kamen, soll nicht weiter erörtert werden. Vermutungen darüber gibt es sonder Zahl, über die sich jeder nach Lust und Laune informieren kann.
„Yukos“ und das Unternehmen, das als „Yukos“-Hauptaktionär fungierte, soll mit Hilfe von „Beratern“ aus den USA sowie aus Großbritannien ein für Außenstehende undurchsichtiges Netzwerk von Gesellschaften und Bankkonten in den Offshore-Steueroasen etabliert haben, um die in Rußland erwirtschafteten Öl-Milliarden möglichst am russischen Fiskus vorbei in „Sicherheit“ zu bringen.
2001 gründete Chodorkovsky in London die „Open Russia Foundation“, die ab 2002 hauptsächlich von den USA aus agierte, um die wirtschaftliche Öffnung Rußlands zu fördern. Ein Jahr später kam in Schlingern, was so vielversprechend begonnen hatte.
Am 19. Juni 2003 wurde der Sicherheitschef von „Yukos“ verhaftet, dem man Anstiftung zum Mord vorwarf. Gleichzeitig begann der Generalstaatsanwalt der Russischen Föderation mit einer Serie von Ermittlungen gegen „Yukos“ und den „Yukos“-Hauptaktionär. Dessen Chef wurde am 2. Juli 2004 festgenommen. Rund zwei Wochen später gab der russische Generalstaatsanwalt in Moskau bekannt, daß gegen fünf „Yukos“-Mitarbeiter wegen Mord und versuchten Mordes ermittelt wird. Landesweit wurden Manager von „Yukos“ und des Hauptaktionärs sowie Aktionäre festgenommen. Büros des „Yukos“-Konzerns und seiner Tochterfirmen wurden durchsucht, und am 25. Oktober 2003 der „Yukos“-Chef selbst vom russischen Geheimdienst FSB auf dem Flughafen von Nowosibirsk in Sibirien verhaftet wurde. Der Vorwurf gegen ihn lautete Steuerhinterziehung, die ihm mit einer phantasievollen, aber durchaus gesetzeskonformen Argumentation angelastet wurde.
Wer glaubt, bereits hier wären die US-Pläne gescheitert, der irrt. Aufdecker vermuten das genaue Gegenteil, denn am 3. November 2003 nahm ein Exil-Russe mit amerikanischem Paß Platz auf dem Chefsessel. Die wichtigsten Management-Positionen bei „Yukos“ waren schon kurz nach der „Yukos“-Privatisierung mit Amerikanern besetzt worden.
An dieser Stelle ein Wort zum vormaligen „Yukos“-Chef. Anscheinend fühlte sich Chodorkovsky nach wie vor auch mit Rußland verbunden. Ihm war lediglich eine ausländische Beteiligung an „Yukos“ von 20 bis 40 Prozent vorgeschwebt. Wegen einer solchen hatte er bereits Verhandlungen mit US-Konzernen aufgenommen. Mit 20-40 Prozent dürften sich die Globalisierer aber wohl nicht zufriedengegeben haben.
Manche Insider, die natürlich nicht genannt werden wollen, meinen die USA hätten die Übernahme der Kontrolle von „Yukos“ konspirativ vorbereitet, wobei der Sturz ihres russischen „Freundes“ Chodorkovsky eine zentrale Rolle spielen sollte. Der springende Punkt war eine Abtretungsklausel, die für den Fall der Entführung oder einer Haftstrafe Chodorkovskys, wie auch des Verlustes eines wichtigen „Yukos“-Teilbetriebs, eine Übertragung von 59,5 Prozent des Konzerns an einen mittlerweile im Ausland residierenden Großaktionär vorsah. Damit würde der Ölriese schlagartig und vollständig unter die Kontrolle der USA kommen. Mit der Festnahme des Oligarchen im Oktober 2003 und der Eröffnung eines Gerichtsverfahrens gegen ihn durch den russischen Generalstaatsanwalt schien eine Haftstrafe für Chodorkovsky vorprogrammiert. Mit seiner Verurteilung würde er seine Anteile an Yukos automatisch verlieren. Es brauchte also lediglich belastendes Material nach Moskau lanciert zu werden. Genauso schien es zu laufen.
Mit der Verhaftung von Chodorkovsky und der Inthronisierung des besagten Exil-Russen mit amerikanischem Paß, waren die USA kurz vor dem Ziel. Endgültig erreicht zu haben schienen sie es, nachdem der neue Chef ein halbes Jahr später von einem „lupenreinen“ Amerikaner aus dem amerikanischen Bundesstaat Kansas abgelöst wurde. Jedoch, der Plan ging nicht auf. Wie Insider überzeugt sind, hat der russische Bär den Plan durchschaut und den amerikanischen Seeadler mit seinen eigenen Waffen geschlagen.
Das Verfahren gegen Chodorkovsky wurde von der russischen Justiz in die Länge gezogen. Den Amerikanern begann die Zeit davonzulaufen. Nachdem Appelle und Mahnungen an die Adresse Putins nichts fruchteten, wurde die „Medien-Front“ eröffnet. Man begann Putin als „Kommunisten“, „neuen Stalin“ und „Tyrannen“ herzustellen. Im Chor begannen die Freunde in der westlichen Welt aufzuheulen. Sie verlangten Gerechtigkeit, Rechtstaatlichkeit, etc. für Chodorkovsky, die ganze Palette. Geschah das, um dem Oligarchen zu helfen? Die Aufdecker meinen, man wollte damit vielmehr eine schnelle Verurteilung provozieren. Gegenüber den Bevölkerungen der westlichen Länder mußte die Aufforderung, rechtsstaatliche Grundsätze einzuhalten, wie ein Engagement für Chodorkovsky erscheinen. Die russische Bevölkerung hingen mußte diese Einmischung ergrimmen und ihr den Wunsch wecken, Chodorkovsky umgehend nach den geltenden russischen Gesetzen abgeurteilt zu sehen. Die vorgeworfene Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe war schließlich keine Kleinigkeit.
Eine raffinierte Manipulation, aber trotzdem nicht erfolgreich.
Während der Prozeß auf sich warten ließ, nahm Putin die Steuerschulden von „Yukos“ zum Anlaß, die „Yukos“-Öltochter „Yuganskneftegas“ per Zwangsversteigerung und gemäß russischer Gesetze völlig legal wieder in russischen Staatsbesitz überzuführen. Damit traten zwar „wegen des Verlustes eines wichtigen Teilbetriebs“ die Abtretungsstatuten in Kraft, doch ohne das Kernstück „Yuganskneftegas“ war der „Yukos“-Konzern nur noch eine fast „leere Hülle“. Diese wurde völlig korrekt an den im Ausland befindlichen Großaktionär abgetreten.
Als „Yuganskneftegas“ kurz vor Weihnachten 2004 von der bis dahin völlig unbekannten russischen „Baikal Finans Group“ - einer eiligst gegründeten Tarnfirma der russischen Regierung - für 9,1 Milliarden Dollar ersteigert wurde, hatte Amerika das Nachsehen. Der russische Präsident hatte war Sieger. Die im Mai 2005 erfolgte Verurteilung von Chodorkovsky wurde allseits erwartet, wobei in Rußland weitgehend zugestimmt wurde, während im Westen einhellig von Politjustiz die Rede war. Nur ein einziges Mal wurde in dem Zusammenhang im TV verschämt die Frage aufgeworfen, woher der von seinem Thron gestürzte „reichste Mann Rußlands“ eigentlich sein Startkapital zum Kauf des Riesenkonzerns her hatte, als er noch ein „einfacher Russe“ war wie Millionen andere auch (zumindest ist mir keine weitere Erwähnung dieses erwähnenswerten Umstandes aufgefallen).
Als Fazit erhebt sich für manche die Frage, wieso in der internationalen Öffentlichkeit ein so verzerrtes Bild dieser Affäre entstehen konnte - wie auch sonst, wenn Volksvermögen, das unter dubiosen Umständen privatisiert wurde, in den Schoß des Staates rückgeführt wird. Medienkritische haben eine Antwort.
Für sie ist es klar, daß der Kreml mangels ausgebuffter PR-Fachleute von US-Zuschnitt, für die es kein Problem ist, Imperialismus als Demokratie-Export zu deklarieren, den „Fall Yukos“ und das Strafverfahren gegen Michail Chodorkowski und Komplizen nicht medienwirksam verkauft hat. Gleichzeitig wurden Korrespondenten der Mainstream-Medien aus dem Westen von genau solchen PR-Profis sowie von der von einer Advokatenriege laufend mit Informationen versorgt. So konnte sich im öffentlichen Bewusstsein festsetzen, das Gerichtsverfahren sei „politisch motiviert“, ein „Schauprozeß“, bei dem es „erhebliche rechtsstaatliche Mängel“ gebe, „eine Rache des Kreml“ usw. Zur Meldung, US-Präsident Bush würde das Chodorkowski-Urteil wie auch die verhängte Haftstrafe kritisieren, meinen manche nur lapidar: „No, na?“
Vom erdrückenden Beweismaterial, das die Staatsanwaltschaft vorgelegt hat, ist kaum die Rede. Das verwundert viele Insider nicht, da die meisten West-Journalisten der Verlesung des 1000 Seiten umfassenden Urteils, in dem alle strafbaren Fakten aufgezählt wurden, mangels ausreichender Sprachkenntnisse nicht folgen konnten.
Eine engagierte deutsche Politikerin, die zu den Kritikerin des russischen Rechts- und Justizsystems zählt, konnte folgende auf den Fall bezogenen Fragen nicht beantworten: „Wie würden Sie es strafrechtlich und auf Deutschland bezogen bewerten, wenn ein deutsches Unternehmen hier geförderte Kohle zu Dumpingpreisen an Offshore-Firmen in Steueroasen verkauft, um sie anschließend zu den regulären und weitaus höheren Marktpreisen weiterzuverkaufen, jedoch in Deutschland nur Steuern auf die Dumpingpreis abführt, die Erlöse aus der Differenz zwischen Dumpingpreisen und Marktpreisen aber als nahezu steuerfreien Gewinn über Steuerparadiese in die eigene Tasche wirtschaftet und damit dem Ursprungsland des Rohstoffs die normalerweise zu zahlende Steuern auf die erzielten, marktgerechten Verkaufserlöse vorenthält? Wäre ein solches Steuerverkürzungsmodell durch die deutsche Steuergesetzgebung gedeckt und könnte es hierzulande von jedermann in jeder Branche ungestraft angewandt werden? Oder wäre das nicht auch in Deutschland ein Betrug, der strafrechtlich verfolgt werden muß?“
Eine deutsche Ex-Politikerin meinte als Beauftragte des Europarates zum „Yukos“-Verfahren: „Es ist zu befürchten, daß hier die Kontrolle über strategisch wichtiges wirtschaftliches Vermögen zurückerlangt werden soll“, worauf manche meinten: „Na und? Hätte sie korrekter Weise statt Vermögen „Volksvermögen“ gesagt, hätte sie vielleicht die Frage beantworten müssen, wieso dieses um ein Pappenstiel in Privatbesitz gelangen konnte und was an dessen Rückführung in Staates Hand eigentlich so schändlich ist.“
Wenn auch die mediale Präsentation für den russischen Präsidenten kein voller Erfolg gewesen sein dürfte, so doch wohl das praktische Ergebnis. Abgesehen davon, war sogar im Westen vereinzelt Zustimmung zu vernehmen. Während manche Putins Finanzjongliererei als solcher Respekt zollten, meinten andere simpel: Er hat dem Volk gestohlenes Volkseigentum wieder zurückgeholt. Arg frustriere Westler entdecken hierin sogar einen ersten Silberstreif am Horizont, indem sie annehmen, hier sei die Globalisierungs- und Privatisierungswalze erstmals zurückgerollt worden, und in dem sie hoffen, dieses Beispiel möge Schule machen. Mediale Verbreitung finden solche Vorstellungen in der „freien Presse des Westens“ allerdings nicht - wohl aber in „Mythos Informationsgesellschaft. Was wir aus den Medien nicht erfahren“.
[ zurück ]